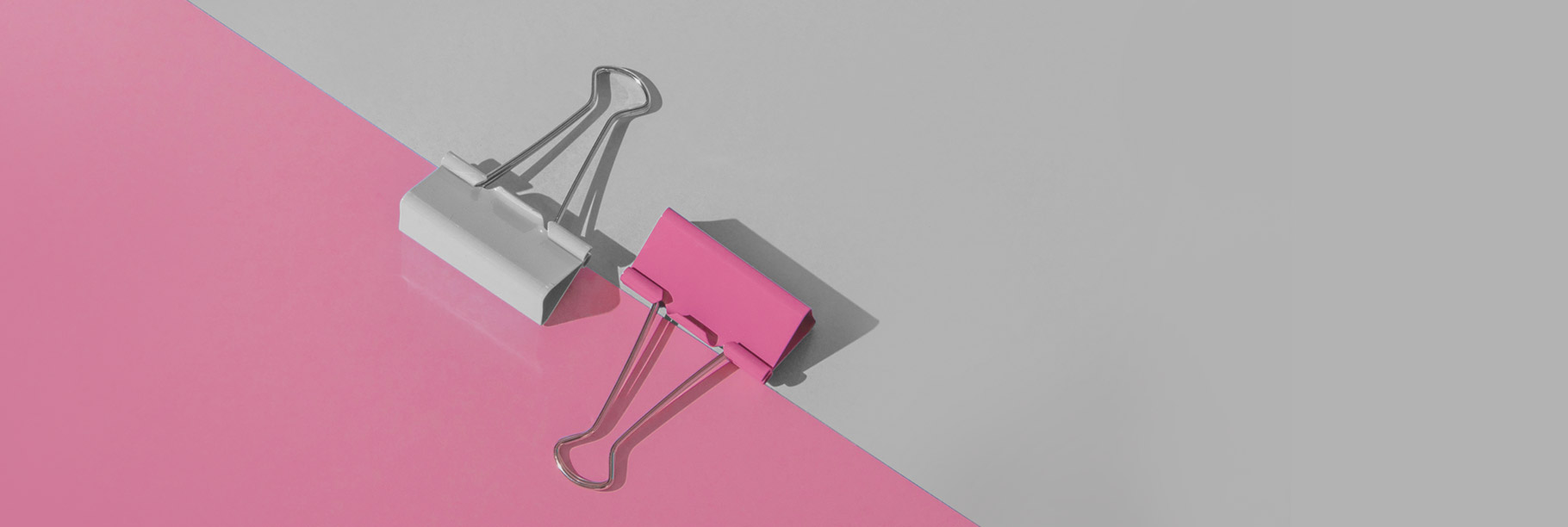
Volksschule der Zukunft
Pädagogische Innovation geschieht in der Volksschule.
2025 Die Schule der Zukunft muss politische Bildung in ihr Zentrum rücken!
Wenn Donald Trump als Präsident der USA und als vorläufig mächtigster Mann der Welt, seine Gegner als «loser» und «dope», als «crazy» und «fat», als «clown», «pig» und «rat» bezeichnet, dann wird politische Bildung und Demokratieerziehung zur vordringlichsten Aufgabe unserer Volksschule.
Zwar muss politische Bildung nach wie vor darauf bestehen: Streitpunkte mit Anstand und gegenseitigem Respekt aushandeln. Aber gleichzeitig muss politische Bildung heute unter allen Umständen heissen: Sich mit Kraft dagegen wehren, wenn Politiker den Anstand verletzen und die demokratischen Regeln verachten. Auf keinen Fall darf die Volksschule darauf vorbereiten, mit Anstand, Bescheidenheit und Respekt jede Ungeheuerlichkeit der autoritären Kleptokraten dieser Welt hinzunehmen.
Ein knappes Zwölfpunkteprogramm für Demokratieerziehung soll sich in die Diskussion über den Aufbau einer politischen Bildung einreihen, die an der Volksschule kein Randdasein mehr fristet, sondern in ihr Zentrum rückt. Ganz im Sinne des Zürcher Pädagogen und Bildungspreisträgers Dieter Rüttimann, der postuliert hat: «Die Schule ist der Ort, wo die Verteidigung der westlichen Demokratie gegen autoritäre Systeme beginnt.» Mehr auf »Demokratie verteidigen«.
—> Zwölfpunkteprogramm

—> »Wir brauchen mehr Geschichtsunterricht!« (TA, 6.3.25, Sandra De Vito/Rudolf Isler)
2025 Integration
Integration ist genau genommen keine Frage der Zukunft unserer Schule. Integration ist eine Entwicklungstendenz moderner, aufgeklärter Gesellschaften. Sie mag sich in Auf-und-ab-Bewegungen fortschreiben, aber auf lange Sicht kann sie nicht rückgängig gemacht werden – es sei denn um den Preis unserer kulturellen Errungenschaften und unserer modernen demokratischen Welt.
Mit Claude Bollier und Dieter Rüttimann entstand ein ganz kurzer programmatischer Artikel für den Tages-Anzeiger, der zeigt, dass der integrative Weg für die Zukunft der Volksschule alternativlos ist.

—> »Inklusion ist für alle Kinder gut« (TA, 17.1.2025, Claude Bollier/Rudolf Isler/Dieter Rüttimann)
2023 Pädagogische Antworten auf gesellschaftliche Individualisierung und Digitalisierung
Ausgangspunkt eines Strategie-Workshops mit dem Bündner Schulinspektorat waren die Analysen von Andreas Reckwitz in «Gesellschaft der Singularitäten» und «Das Ende der Illusionen». Inwiefern wird eine singularisierte Gesellschaft zur Herausforderung für die Volksschule?
Im Zuge von Individualisierungsprozessen entsteht in sozial gut abgesicherten Gesellschaften eine neue Mittelklasse mit einem «singularistischen» Lebensstil (Reckwitz). Er prämiert Besonderheit, Einzigartigkeit und Superlative. Er ist an qualitativer Differenz, Individualität und am Aussergewöhnlichen orientiert. Dieser Lebensstil wird gesellschaftlich dominanter. Er erzeugt in unterschiedlichsten Gruppen den Wunsch nach alternativen und einzigartigen Schulen, die dem eigenen Lebensstil entsprechen und sich der Einheitlichkeit der staatlichen Schulen entziehen. Dadurch steht die Volksschule in den nächsten Jahren vor der Aufgabe, den zentrifugalen Kräften eine vertretbare Einheitlichkeit entgegenzusetzen, gleichzeitig aber auch unterschiedlichste Ansprüche und Wünsche verschiedener Bevölkerungsgruppen zu integrieren.
(Paraphrase aus: Reckwitz, A. 2019. Das Ende der Illusionen. Suhrkamp, 7. Aufl.).

2022 Ein Diskussionspapier für die Weiterentwicklung der Bündner Volksschule
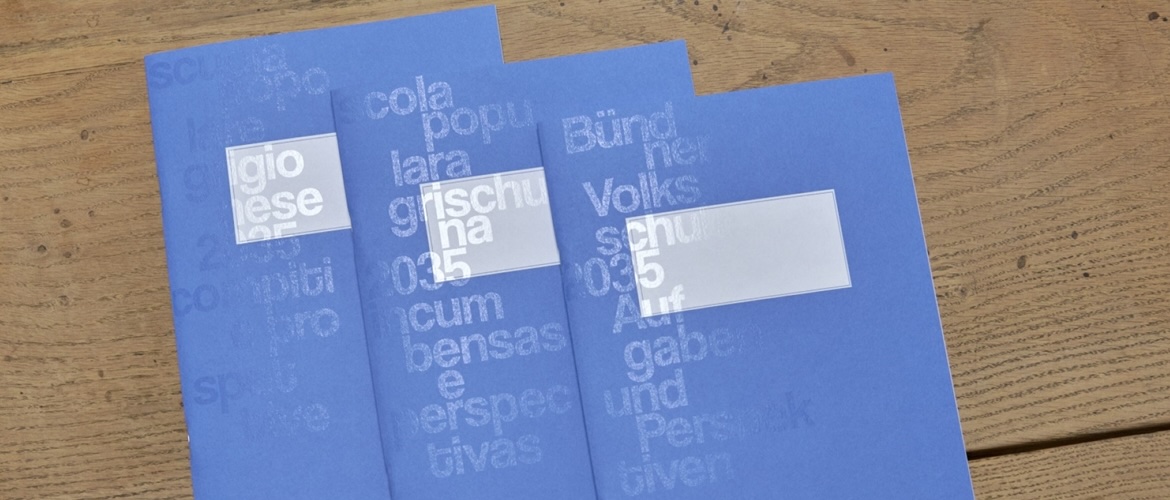
Resultat der zweijährigen Arbeit mit dem Amt für Volksschule und Sport des Kantons Graubünden:
—> «Bündner Volksschule 2035 – Aufgaben und Perspektiven»
Innovation in der Volksschule des Kantons Graubünden: fundiert, realitätsnah, nachhaltig. Es wird das Stereotyp entkräftet, dass nur «freie» Schulen kreativ sind.
2022 Beziehung als Basis für die Förderung von Sachverstand und Selbstvertrauen
«Am Mittwoch, 7. September, trafen sich Lehrerinnen und Lehrer aus dem ganzen Kanton in der Aula der Kantonsschule zum 4. Bildungstag. Flüchtlingskinder, Mangel an Lehrpersonen, digitale Transformation – das waren einige der Herausforderungsfelder, die Bildungsdirektor Regierungsrat Markus Heer im Grusswort nannte. Danach fegte Prof. Dr. Rudolf Isler von der PH Zürich 45 Minuten lang eine Reihe von Bedenken weg. Es war geradezu erfrischend.»
Bildungstag der Glarner Lehrer:innen (2022, Online Portal GLARUS24)
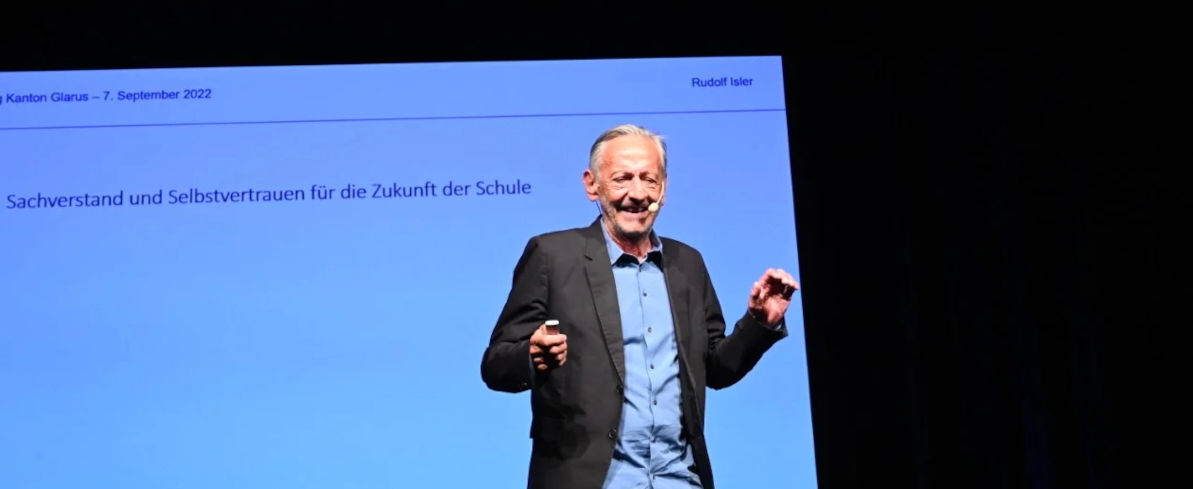
—> Kurzzusammenfassung des Referates auf GLARUS24
Sauerstoff für die Volksschule heisst: unterschiedliche Vorstellungen von Bildung und Erziehung im öffentlichen Dialog behalten.
Eine Institution, die den öffentlichen Dialog über Bildung fördert, ist die Stiftung Pestalozzianum
(seit 1875, mit neuer Orientierung seit 2003).
Wir vereinen Menschen, die sich über die üblichen Grenzen des Alltags hinweg für eine starke Volksschule und für ein leistungsfähiges öffentliches Bildungssystem in der Schweiz einsetzen.
Wir fördern den Dialog über öffentliche Bildung und vermitteln Wissen über die Bildungsgeschichte. Dies tun wir auf der Basis der «Sammlungen Pestalozzianum».

